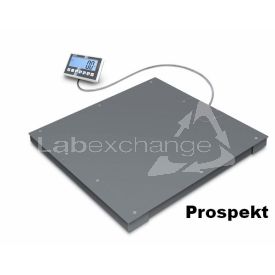Waagen (Sonstige)
-
Waagen (Sonstige) Mettler ICS425k-XS/fID-Nummer: 47008Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät940,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern BFC 1.5T-4MID-Nummer: 46254Versand: 4-6 WochenStatus: Anbieter1.160,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFE 100K-2LNM-AID-Nummer: 45340Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät325,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSXC 30K-3M-AID-Nummer: 45339Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät600,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFE 30K-2NM-AID-Nummer: 45338Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät245,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFE 10K-3LNM-AID-Nummer: 45337Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät300,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFE 10K-3LNM-AID-Nummer: 45336Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät300,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFE 10K-3LNM-AID-Nummer: 45335Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät300,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFE 10K-3LNM-AID-Nummer: 45334Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät300,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 100H-2H-AID-Nummer: 45326Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät395,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 50K-3LH-AID-Nummer: 45332Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät410,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 50K-3LH-AID-Nummer: 45331Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät410,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 30K-2HM-AID-Nummer: 45330Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät435,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 30K-2HM-AID-Nummer: 45329Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät435,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 20K-3H-AID-Nummer: 45328Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät425,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TSFB 10K-3H-AID-Nummer: 45327Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät465,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern IXS 30K-2LMID-Nummer: 45326Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät465,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TKXC-TM-AID-Nummer: 45318Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät750,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TKXC-TM-AID-Nummer: 45317Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät750,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TKXC-TM-AID-Nummer: 45316Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät750,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TIXC 30K-3L-AID-Nummer: 45315Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät430,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TIXC 150K-3L-AID-Nummer: 45314Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät510,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TIXC 6K-4-AID-Nummer: 45313Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät505,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
-
Waagen (Sonstige) Kern TIFB 150K20DM-AID-Nummer: 45312Versand: 10-14 WerktageStatus: Lagergerät345,00 €Exkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Eine Waage dient zur Bestimmung der Masse. Dies erfolgt in der Regel über die Gewichtskraft, die entweder direkt messbar ist, oder mit einer Gewichtskraft einer bekannten Masse verglichen werden kann. Waagen, die nach dem ersten Prinzip funktionieren, müssen, aufgrund der unterschiedlichen Schwerebeschleunigung, am entsprechenden Ort justiert werden. Grundsätzlich gilt folgender Zusammenhang: Die Masse setzt sich aus dem Quotienten der Gewichtskraft und der Schwerebeschleunigung zusammen.
Geschichte der Waage
In einem prähistorischen Grab in Ägypten wurde ein Waagebalken aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. entdeckt. Die erste ägyptische Abbildung einer einfachen Balkenwaage stammt aus dem Jahr 2000 v. Chr.. Ca. 500 v. Chr. wurde die Genauigkeit der Balkenwaage durch die Etrusker verbessert. Die Römer setzten bereits ungleicharmige Waagen ein. Der längere Arm verfügt über ein verschiebbares Wägestück und über eine Strichmarkierung. In der Renaissance wurden erstmals hochempfindliche Analysewaagen in alchimistischen Labors eingesetzt. 1669 wurde von dem Franzosen Joachim Rosentahl de Romée die Tafelwaage erfunden. Bei dieser hatte die Position des zu wiegenden Produktes keinen Einfluss auf das Wägeergebnis. Philipp Matthäus Hahn baute 1763 eine Neigungswaage mit direkter Gewichtsanzeige. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Dezimal- und die Küchenwaagen entwickelt. 1939 begann mit der Entwicklung der elektrischen Widerstandsänderung das Zeitalter der elektronischen Waage.
Mechanische Waagen
Bei mechanischen Waagen kann zwischen den bereits angesprochen Prinzipien, die Gewichtskraftmessung und der Massenvergleich, unterschieden werden.
Gewichtskraft
Bei der Federwaage wird das Objekt an eine Schraubenfeder gehängt und die Verlängerung gemessen. Mittels einer Federkonstante kann die Gewichtskraft ermittelt und als Masse abgebildet werden. Grundsätzlich gibt es verschiedene Federwaagen für die unterschiedlichen Messbereiche. Als Beispiele können die Haushaltswaage, die Küchenwaage, die Personenwaage und die Mikrowaage genannt werden.
Massenvergleich
Beim Massenvergleich wird die Masse eines Gegenstandes durch den Vergleich mit Standardgewichten bestimmt. Diese Waagen müssen nicht auf die unterschiedlichen örtlichen Bedingungen eingestellt werden. Die Referenzgewichte beginnen bei 0,1 mg und enden bei 10 kg. Durch eine Balkenwaage kann die Balance zwischen zwei Gewichten gemessen werden. Eine Zeigerwaage oder eine Neigungswaage misst die Auslenkung eines festen Gewichts an einem Hebelarm. Eine Schnellwaage setzt sich aus einem Stab mit einer Skala und zwei ungleichen Hebelarmen zusammen. An einem befindet sich das Ausgleichsgewicht, am anderen das Wägegut. Eine Dezimalwaage verfügt über eine ähnliche Arbeitswaage wie eine Schnellwaage, jedoch ist der Unterschied zwischen den Hebelarmen deutlich größer.
Elektromechanische, elektronische Waagen
Bei elektromechanischen Waagen erfolgt eine direkte Umformung der Gewichtskraft in eine Verformung bzw. einen Weg. Dies erfolgt häufig über eine Feder bzw. einen Biegebalken. Das direkte Verfahren misst die Verformung einer Feder über einen Dehnungsmessstreifen. Die indirekte Messung erfolgt dagegen über eine Wegmessung, beispielsweise bei einer Änderung des Plattenabstandes. Ein typisches Beispiel der elektromechanischen Waagen stellen die Plattformwaage, die Präzisions- und Laborwaage sowie die Tischwaage dar. Eine Plattformwaage besteht aus einer Wiegebrücke mit mehreren Messdosen, Messterminal und Programmen. Präzisions- und Laborwagen verfügen über eine Genauigkeit von bis zu 0,01 %. Tischwaagen sind mit einem Batterie- und mit einem Netzbetrieb verfügbar.
Literatur
•http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waage&oldid=86530885 (Abgerufen: 31.03.11).
•http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waage&oldid=86530885 (Abgerufen: 31.03.11).